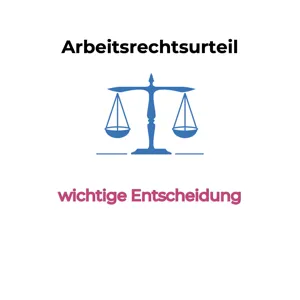Kündigungsfrist für Arbeitnehmer - wo findet man diese?
Wenn man als Arbeitnehmer selbst kündigen möchte, muss man wissen mit welcher Frist die ordentliche Kündigung zulässig ist. Dazu muss man wissen, wo man die Regelungen über die Kündigungsfristen von Arbeitnehmern findet und wie die Fristen dann richtig berechnet werden. Darum geht es in diesem Artikel.
Kündigungsfristen für Arbeitnehmer
Die gesetzlichen Kündigungsfristen für Arbeitnehmer findet man in der Regel im Gesetz (§ 622 BGB) oder im Arbeitsvertrag. Wenn ein Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet, dann geht dieser in Regel als höherrangiges Recht der gesetzlichen Regelung vor.
anwaltliche Beratung
Im Zweifel sollt man eine Kündigung immer durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin überprüfen lassen. Hierfür stehe ich für eine Beratung und Vertretung von Arbeitnehmern in der Kanzlei in Prenzlauer Berg (Zweigstelle) zur Verfügung.
Unterscheidung zwischen Kündigungsfrist und Kündigungstermin
Man muss zunächst unterscheiden zwischen der Kündigungsfrist und dem Kündigungstermin.
| Kündigungsfrist | Kündigungstermin |
|---|---|
| Länge der Frist | Ende des Arbeitsverhältnisses |
| z.B. 4 Wochen | z.B. zum 15. oder zum Monatsende |
Beginn der Fristberechnung
Eine der wichtigsten Grundlagen ist die Berechnung der Kündigungsfrist. Diese ist nicht schwer, aber man muss wissen, von welchem Zeitpunkt (Datum man) man die Berechnung beginnen muss. Der richtige Zeitpunkt ist immer der Zugang der Kündigung bei der Gegenseite und das Datum der Kündigungserklärung.
Muster eines Kündigungsschreibens
Eine kostenlose Vorlage eines Kündigungsschreibens für Arbeitnehmer (Eigenkündigung) finden Sie hier.