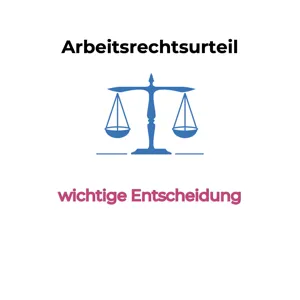Betriebliche Übung – Was ist das und welche Bedeutung hat sie?

Begriff der betrieblichen Übung
Die betriebliche Übung ist ein zentrales „Phänomen“ im Arbeitsrecht, das zur Anspruchsentstehung aufgrund wiederholter freiwilliger Gewährung bestimmter Leistungen durch den Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer oder an bestimmte Arbeitnehmergruppen führt.
Wann liegt eine betriebliche Übung vor?
Sie liegt vor, wenn der Arbeitgeber über einen längeren Zeitraum hinweg bestimmte Leistungen oder Vergünstigungen (z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Sonderzahlungen) regelmäßig, gleichförmig und vorbehaltlos gewährt – und die Arbeitnehmer daraus unter Berücksichtigung von Treu und Glauben (§ 242 BGB) berechtigterweise schließen dürfen, dass diese Leistungen auch künftig gewährt werden.
Ist diese dann für den Arbeitgeber verbindlich?
Aus einer solchen betrieblichen Übung kann ein verbindlicher Rechtsanspruch für die Arbeitnehmer entstehen, der ähnlich wie eine vertragliche Zusage wirkt.
Rechtsgrundlage und Dogmatik
Die betriebliche Übung ist nicht explizit im Gesetz verankert, sondern wurde maßgeblich durch die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) entwickelt und anerkannt. Ihre dogmatischen Grundlagen sind vielschichtig:
Vertragstheorie
Die vorherrschende Vertragstheorie sieht in der regelmäßigen Wiederholung bestimmter Arbeitgeberverhaltensweisen ein konkludentes Vertragsangebot, das der Arbeitnehmer stillschweigend (§ 151 BGB) annimmt. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber tatsächlich einen expliziten Verpflichtungswillen hatte, sondern allein darauf, ob der Arbeitnehmer aus dem Verhalten des Arbeitgebers unter Berücksichtigung aller Begleitumstände auf einen Bindungswillen schließen durfte.
Vertrauenstheorie
Die Vertrauenstheorie argumentiert hingegen, dass die Anspruchsentstehung primär auf dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und § 242 BGB (Treu und Glauben) basiert. Es verstoße demnach gegen Treu und Glauben, wenn der Arbeitgeber wiederholt und vorbehaltlos erbrachte Leistungen einstellt, ohne dass der Arbeitnehmer dies erwarten muss.
Trotz dieser unterschiedlichen dogmatischen Ansätze führen sie in der Praxis häufig zu identischen Ergebnissen bezüglich der Entstehung eines Anspruchs.